Novemberrevolution 1918: Kaiser weg und Republik gleich zweimal
von Tilo Gräser
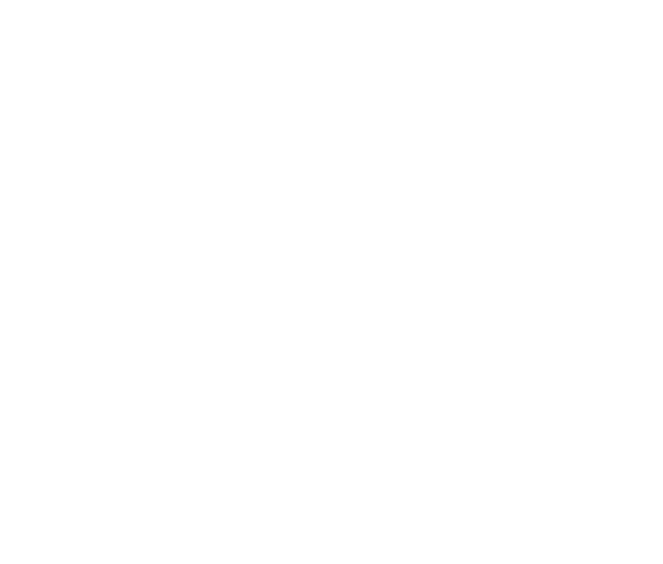
Novemberrevolution 1918: Kaiser weg und Republik gleich zweimal
von Tilo Gräser
Die Ereignisse im November 1918 in Deutschland hatten eine Vorgeschichte. Eine dreiteilige Sputnik-Beitragsserie wirft einen Blick darauf ebenso wie auf das, was am 9. November 1918 geschah. Im ersten Teil geht es um die Lage kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges und die Frage, wer das Ende des Kaiserreiches wollte.
Ende Oktober 1918 habe eine Revolution in Deutschland auf „eine unheimliche, ungreifbare Weise" in der Luft gelegen. Das stellte der Historiker Sebastian Haffner 1969 in seinem Buch „Die verratene Revolution" fest, das heute unter dem weniger deutlichen Titel „Die deutsche Revolution 1918/19" weiter veröffentlicht wird.
„Die Massen, so fürchtete man, würden sich verzweifelt erheben, um den Kaiser loszuwerden, der zwischen ihnen und dem Frieden stand – und wenn sie das täten, würden sie mit ihm zugleich alles hinwegfegen: Monarchie, Staat, Heer und Flotte, Regierung und Obrigkeit, Adel und Großbürgertum."
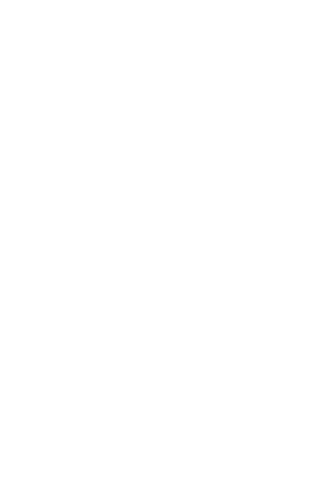
"Unser Kaiser an sein Volk": Ein deutsches Propagandaposter des ersten Weltkriegs.
Das habe nicht nur dem Reichskanzler Max von Baden, sondern auch MSPD-Führer Friedrich Ebert „schwere Sorgen bereitet", stellte Haffner fest, und beide hätten dem zuvorkommen wollen.
Ebert habe das gleiche Programm wie die Regierung gehabt, „die er nach Kräften von außen stützte: Abdankung des Kaisers – schneller Waffenstillstand – Regentschaft – Rettung der Monarchie". Der Kaiser habe die Abdankung wie die Revolution gefürchtet und letztere mit Hilfe des von der Front zurückgekehrten Heeres
niederschlagen wollen. Für diese Aufgabe habe er General Wilhelm
Ebert habe das gleiche Programm wie die Regierung gehabt, „die er nach Kräften von außen stützte: Abdankung des Kaisers – schneller Waffenstillstand – Regentschaft – Rettung der Monarchie". Der Kaiser habe die Abdankung wie die Revolution gefürchtet und letztere mit Hilfe des von der Front zurückgekehrten Heeres
niederschlagen wollen. Für diese Aufgabe habe er General Wilhelm
Groener zum Ludendorff-Nachfolger gemacht. Am 30. Oktober habe Wilhelm II. Berlin verlassen und sei ins deutsche Hauptquartier im belgischen Spa gefahren.
Revolution von unten anders als geplant
Es habe in Berlin „einige Verschwörer" gegeben, hob der Historiker hervor, die erst für den 4., dann für den 11. November Aktionen planten. Gemeint waren die Revolutionären Obleute, geführt von Richard Müller, die sich im Januarstreik 1918 hervorgetan hatten. Dennoch habe niemand gewusst, ob die Massen tatsächlich bereit und fähig zum Aufstand waren, aber ebenso nicht, zu wieviel Widerstand in einem solchen Fall die alten Mächte fähig waren.
„Am Ende waren es nicht die Berliner Revolutionsplaner, die die Revolution in Gang setzten, und es war nicht die ‚Kaiserfrage', die sie auslöste, sondern ein Verzweiflungsakt der Marineleitung, mit dem niemand gerechnet hatte."
Und so rissen die in den letzten Oktobertagen meuternden Matrosen Heimatheer und Arbeiterschaft mit, wie Haffner schrieb.
Der Historiker machte in seinem Buch auf etwas aufmerksam, was auch heute kaum wahrgenommen wird: „Die Massen rebellierten nicht gegen die Regierung. So seltsam es klingt: Sie rebellierten für die Regierung." Die Matrosen glaubten, im Sinne der neuen Regierung zu handeln, als sie sich gegen die eigentliche Meuterei, die der Flottenführung gegen die Regierung und deren Politik, auflehnten – „das ist nachher ständig verwischt worden".
Der Historiker machte in seinem Buch auf etwas aufmerksam, was auch heute kaum wahrgenommen wird: „Die Massen rebellierten nicht gegen die Regierung. So seltsam es klingt: Sie rebellierten für die Regierung." Die Matrosen glaubten, im Sinne der neuen Regierung zu handeln, als sie sich gegen die eigentliche Meuterei, die der Flottenführung gegen die Regierung und deren Politik, auflehnten – „das ist nachher ständig verwischt worden".
Keine Revolte gegen die Regierung
Haffner schätzte das so ein: „Sie war die erste Kraftprobe zwischen Gegenrevolution und Revolution – und den Eröffnungszug machte die Gegenrevolution." Die geplante Seeschlacht hätte alle Bemühungen um einen Waffenstillstand zunichte gemacht.
Die Matrosen glaubten sich im Recht und im Sinne der neuen Regierung handelnd, als sie das Auslaufen verweigerten, so der Historiker. Das habe zum Beispiel ein Matrose auf dem Schlachtschiff „Thüringen" dessen Erstem Offizier erklärt. Zwar sei die Meuterei niedergeschlagen worden, aber das Auslaufen der Flotte aufgegeben worden. Erst als die Meuterer drei Tage später bestraft werden sollten, kam es zum Aufstand
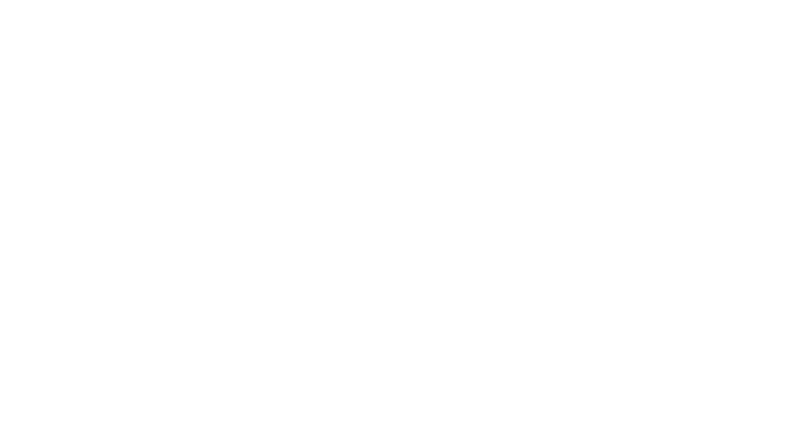
Eine Friedenskundgebung der Matrosen in Kiel im November 1918.
Bundesarchiv, Bild 183-R72520 / CC-BY-SA 3.0 DE
der restlichen Matrosen, die das verhindern wollten, wie Haffner festhielt. „Am Abend des 4. November war Kiel in der Hand von vierzigtausend aufständischen Matrosen und Marinesoldaten."
Berlin schickte unter anderem den späteren selbsternannten sozialdemokratischen „Bluthund" Gustav Noske am 4. November 1918 nach Kiel, um die Matrosen zu beruhigen und ihren Aufstand abzuwürgen. Der Regisseur Klaus Gietinger machte unlängst in der Zeitschrift „Z." auf einen Umstand dabei aufmerksam: „Weniger bekannt ist, dass er schon zu dieser Zeit Deckoffiziersbrigaden (die sog. ‚Eiserne Brigade') gegen die Revolution aufstellen ließ und gleichzeitig sich die desavouierten Offiziere schon auf Hauptmannsebene (Marinebrigade Ehrhardt, Marinebrigade Loewenfeld u. a.) in hoch aggressiv aufgeladenen Freikorps organisierten."
Berlin schickte unter anderem den späteren selbsternannten sozialdemokratischen „Bluthund" Gustav Noske am 4. November 1918 nach Kiel, um die Matrosen zu beruhigen und ihren Aufstand abzuwürgen. Der Regisseur Klaus Gietinger machte unlängst in der Zeitschrift „Z." auf einen Umstand dabei aufmerksam: „Weniger bekannt ist, dass er schon zu dieser Zeit Deckoffiziersbrigaden (die sog. ‚Eiserne Brigade') gegen die Revolution aufstellen ließ und gleichzeitig sich die desavouierten Offiziere schon auf Hauptmannsebene (Marinebrigade Ehrhardt, Marinebrigade Loewenfeld u. a.) in hoch aggressiv aufgeladenen Freikorps organisierten."
Gutmütige Revolution
Die Matrosen aber wähnten Noske auf ihrer Seite und wählten ihn zum „Gouverneur". Für Haffner ein weiterer „Beweis, dass die Rebellen nicht gegen die Regierung rebellierten, sondern für sie und in ihrem Sinne zu handeln glaubten". Ihnen sei außerdem klar gewesen, dass sie nun überall im Land die Macht an sich reißen mussten, „wenn sie nicht in Kiel eingekreist, niedergeschlagen und grausam bestraft werden wollten".
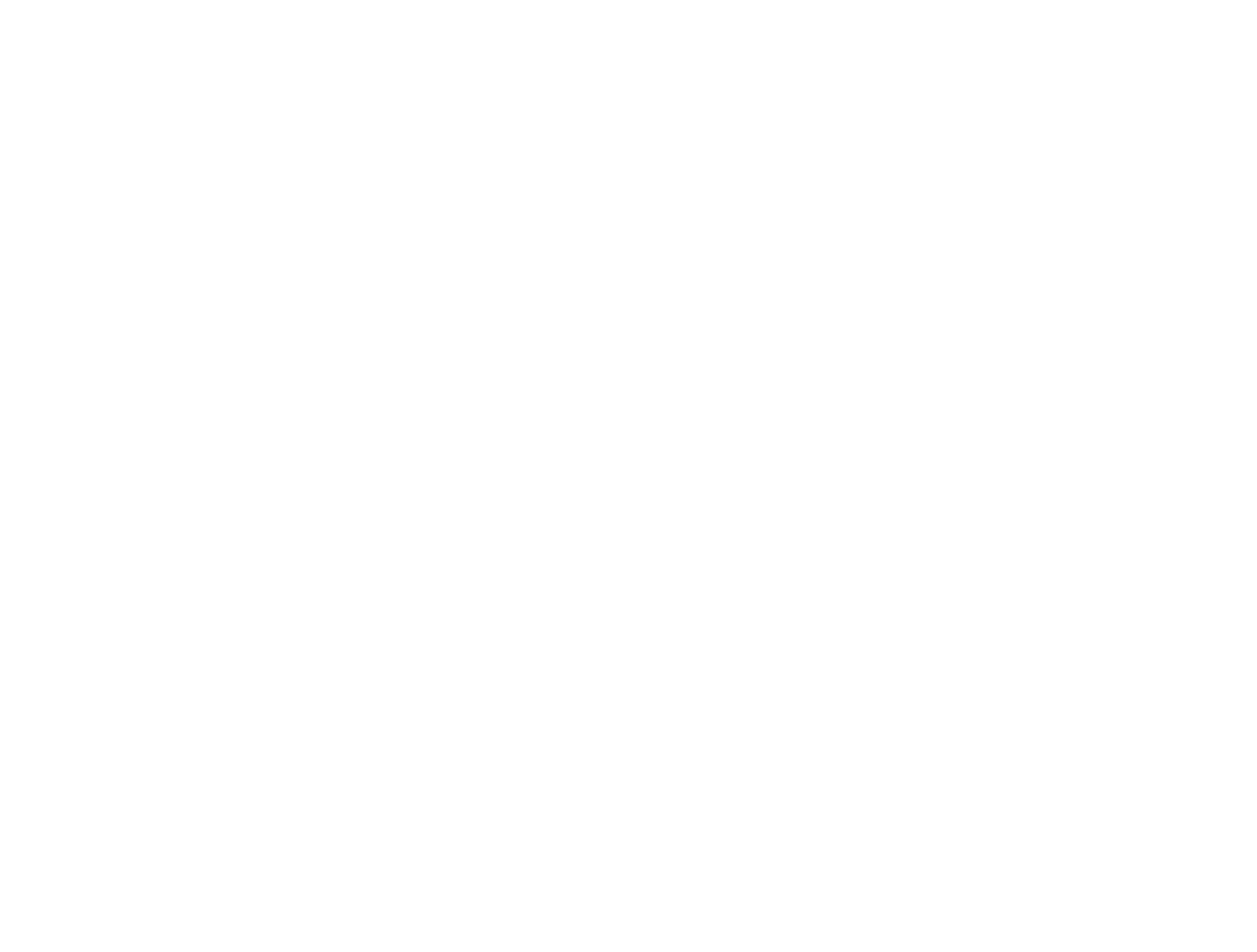
Revolutionäre Soldaten mit der Roten Fahne vor dem Brandenburger Tor in Berlin
National Archives and Records Administration
National Archives and Records Administration
So haben sie von der Küste aus die Revolte, den Aufstand nach Deutschland getragen.
„Überall, wohin die Matrosen kamen, schlossen sich ihnen die Soldaten der Garnisonen und die Arbeiter der Fabriken an, als ob sie auf sie gewartet hätten; fast nirgends gab es ernstlichen Widerstand; überall riss die bestehende Ordnung wie mürber Zunder."
Am dritten Tag habe sich der Aufstand auch dort fortgepflanzt, wo die Matrosen nicht hinkamen.
Laut Haffner gab es nur wenig Widerstand, Gewalt und Blutvergießen. Auf beiden Seiten habe Verblüffung über den leichten Gang der Dinge vorgeherrscht. „Die Revolution war gutmütig. Es gab keine Lynchjustiz und keine Revolutionstribunale. Viele politische Gefangene wurden befreit, aber niemand wurde verhaftet." Doch der Historiker wies auch daraufhin: „Der siegreichen Masse hilft es wenig, gutmütig zu sein, die besiegten Herren verzeihen ihr den Sieg nicht." Diese Erfahrung mussten schon die Revolutionäre in Russland ein Jahr zuvor machen.
Laut Haffner gab es nur wenig Widerstand, Gewalt und Blutvergießen. Auf beiden Seiten habe Verblüffung über den leichten Gang der Dinge vorgeherrscht. „Die Revolution war gutmütig. Es gab keine Lynchjustiz und keine Revolutionstribunale. Viele politische Gefangene wurden befreit, aber niemand wurde verhaftet." Doch der Historiker wies auch daraufhin: „Der siegreichen Masse hilft es wenig, gutmütig zu sein, die besiegten Herren verzeihen ihr den Sieg nicht." Diese Erfahrung mussten schon die Revolutionäre in Russland ein Jahr zuvor machen.
Sozialdemokratische Revolutionäre
Die anfangs Besiegten, die später mit Hilfe von Ebert und Noske wieder zu Siegern wurden, hätten später vor allem die Geschichte der Novemberereignisse 1918 in Deutschland geschrieben, so Haffner. Nach seinem Urteil fegte zwischen dem 4. und 10. November 1918 westliche der Elbe eine echte Revolution die alten Obrigkeiten hinweg und ersetzte sie durch Arbeiter- und Soldatenräte. „In dieser Woche verwandelte sich das westliche Deutschland aus einer Militärdiktatur in eine Räterepublik." Dabei sei kein Chaos entstanden oder geschaffen worden, sondern „die rauen und ungehobelten, aber klar erkennbaren Elemente einer neuen Ordnung".
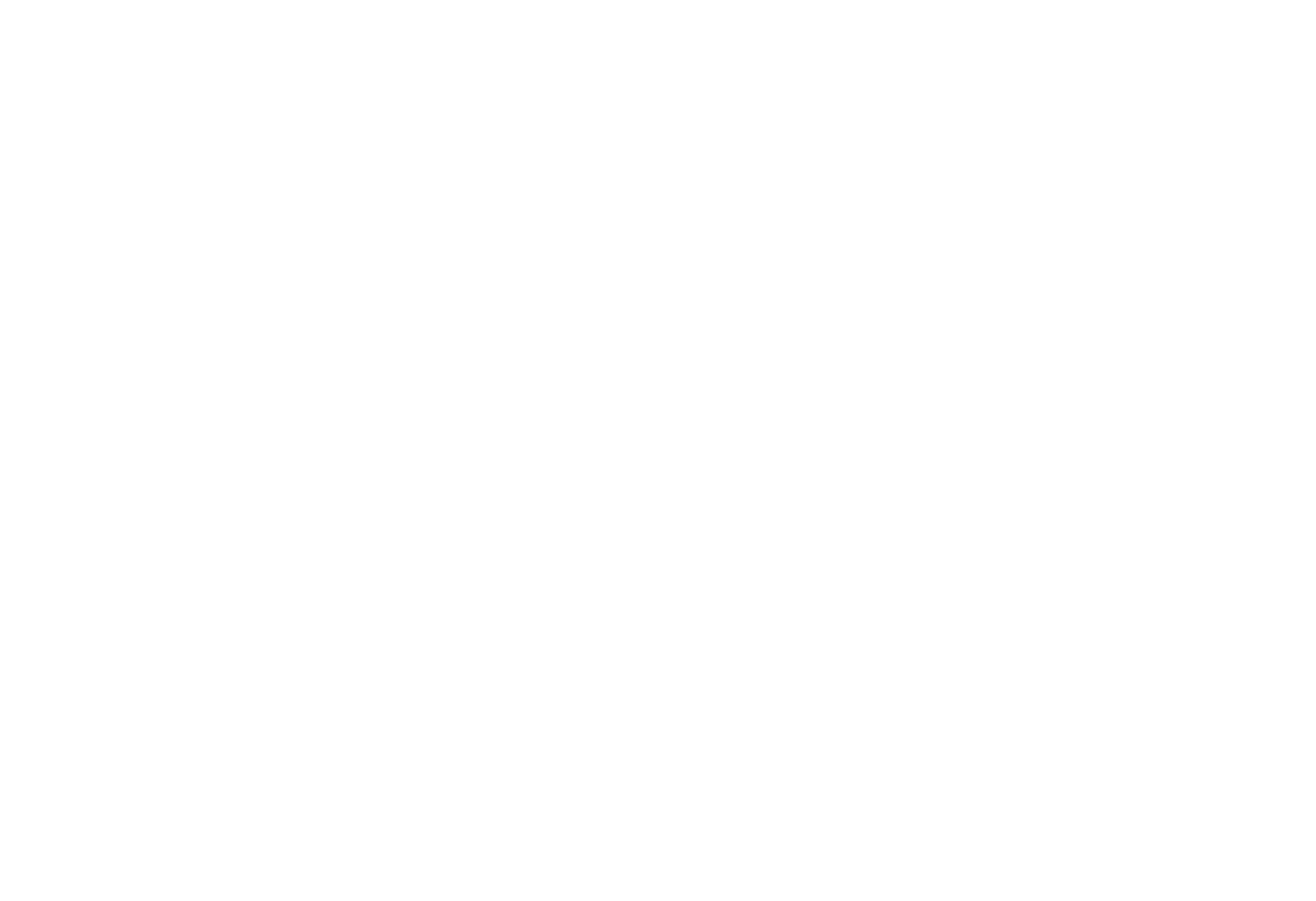
Reichsversammlung der Arbeiter- und Soldatenräte am 16. Dezember 1918
National Archives and Records Administration
National Archives and Records Administration
„Das Merkwürdigste an den Vorgängen dieses historischen Tages ist, wie undramatisch und gedämpft, wie glatt und selbstverständlich sich alles abspielte", gerade angesichts von vier Jahren blutigem Weltkrieg zuvor, stellte Haffner 50 Jahre später fest. „Die verfassungsmäßigen Gewalten des Kaiserreichs hatten an diesem 29. September kampflos kapituliert; sie hatten in gewissem Sinne schon abgedankt." Allerdings hätten die beschlossenen Veränderungen in der deutschen Politik, bis zur Mehrheits-SPD (MSPD) unter Friedrich Ebert, und beim deutschen Militär „wie eine Bombe" eingeschlagen.
Das von Ludendorff geplante und durchgesetzte Abwälzen der Verantwortung für die Niederlage auf die führenden rechten Sozialdemokraten war die Grundlage für die kurz danach verbreitete „Dolchstoßlegende". Er habe die Veränderungen auch damit begründet, dass unbedingt verhindert werden müsste, dass mit den im Westen weiter vorrückenden Truppen einschließlich denen der USA die Revolution nach Deutschland getragen wird.
Das von Ludendorff geplante und durchgesetzte Abwälzen der Verantwortung für die Niederlage auf die führenden rechten Sozialdemokraten war die Grundlage für die kurz danach verbreitete „Dolchstoßlegende". Er habe die Veränderungen auch damit begründet, dass unbedingt verhindert werden müsste, dass mit den im Westen weiter vorrückenden Truppen einschließlich denen der USA die Revolution nach Deutschland getragen wird.
Revolution auch in Bayern
Die russische Revolution 1917 habe eine „anfeuernde Fernwirkung" gehabt, aber es habe keine russischen Emissäre in Deutschland gegeben, die die Ereignisse versuchten zu steuern, so Haffner. Doch all das half den deutschen Revolutionären nichts – ihre Gegner, die alten Mächte gemeinsam mit der MSPD-Führung, sahen in ihnen „Bolschewisten" und begannen sie mit allen Mitteln zu bekämpfen.
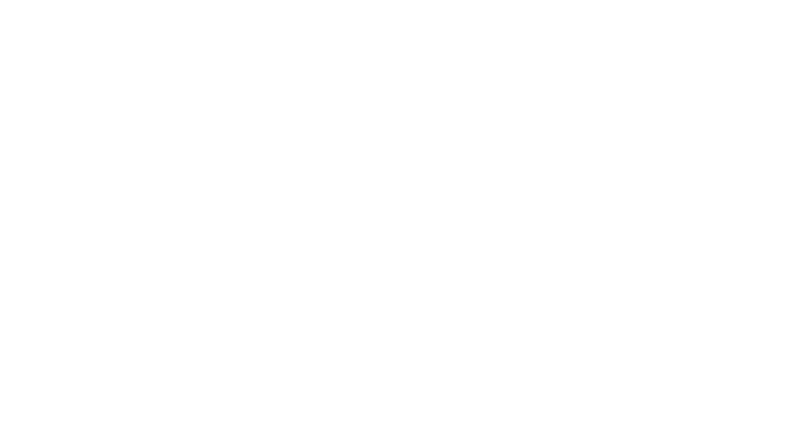
Soldaten und bewaffnete Zivilisten auf Lastauto in München
Auch die bereits am 7. November in München begonnene Revolution war laut Haffner „nicht gegen die neue Regierung, im Gegenteil". Die bayrischen Revolutionäre hätten wie die Kieler Matrosen geglaubt, der neuen Reichsregierung zu helfen. Sie wollten nach seinen Schilderungen den Frieden befördern, der „nicht nur das Werk der ‚Herren da oben' sein" sollte – „die Massen selbst wollten
das nachvollziehen und zum Durchbruch bringen, was, nach ihrer Meinung, die neue Regierung eingeleitet hatte und womit sie nicht recht weiterzukommen schien".
Der Historiker stellte fest: „Die ‚Revolution von unten' wollte die ‚Revolution von oben' nicht kassieren, sondern ergänzen, beleben, vorwärts treiben, recht eigentlich erst zur Wirklichkeit machen. Wogegen sie sich richtete, das war nicht die neue parlamentarische Reichsregierung, sondern die immer noch mit Belagerungszustand, Zensur und Schutzhaft als Nebenregierung funktionierende Militärdiktatur."
Der Historiker stellte fest: „Die ‚Revolution von unten' wollte die ‚Revolution von oben' nicht kassieren, sondern ergänzen, beleben, vorwärts treiben, recht eigentlich erst zur Wirklichkeit machen. Wogegen sie sich richtete, das war nicht die neue parlamentarische Reichsregierung, sondern die immer noch mit Belagerungszustand, Zensur und Schutzhaft als Nebenregierung funktionierende Militärdiktatur."
Mit wem sich Friedrich Ebert einig war
Die sozialdemokratischen Massen hätten einen neuen Volks- und Friedensstaat angestrebt und sich darin mit ihren Führern wie Ebert, Scheidemann und Noske einig geglaubt. „Dass sie sich täuschten, wurde ihre Tragödie", so Haffner. Und diese habe bereits in Kiel begonnen, wo „Noske im Namen der Revolution die Revolution erfolgreich abgeblasen" und nicht nur Ruhe und Ordnung, sondern ebenso die Autorität der gedemütigten Offiziere wieder hergestellt hatte.
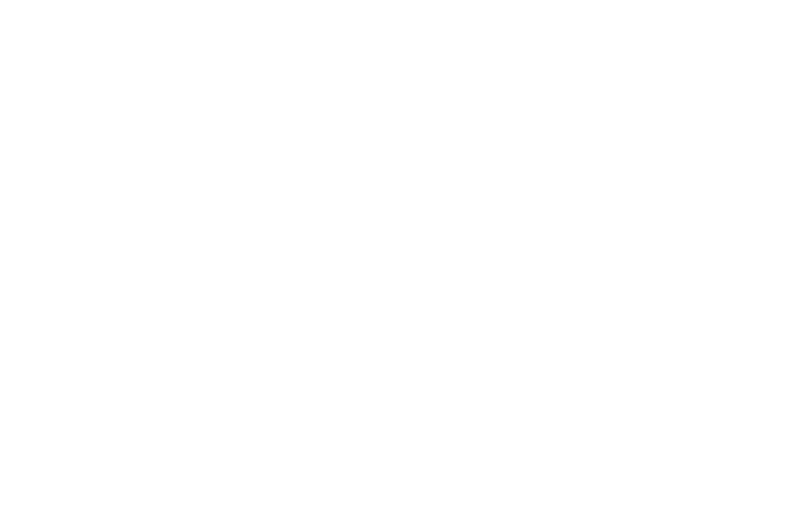
Die Volksbeauftragten (v.l.n.r.): Otto Landsberg, Philipp Scheidemann, Gustav Noske, Friedrich Ebert und Rudolf Wissell im Dezember 1918
Bundesarchiv, Bild 146-1977-074-08 / Sennecke, Robert / CC-BY-SA 3.0 DE
Bundesarchiv, Bild 146-1977-074-08 / Sennecke, Robert / CC-BY-SA 3.0 DE
Das gemeinsame Anliegen der drei Machtzentren – Kaiser und Oberste Heeresleitung unter Hindenburg und Groener, Reichsregierung unter Prinz Max von Baden sowie MSPD-Führung unter Ebert – sei es gewesen, die revolutionäre Bewegung zurückzurollen. Am 6. November kam den Berichten nach Bewegung in die Frage des Waffenstillstandes, als US-Präsident Wilson den Verhandlungen zustimmte. Aber während der Kaiser die so freiwerdenden Truppen von der Westfront gegen die revolutionäre Heimat marschieren lassen wollte, hätten OHL-Chef Groener und Kanzler Max von Baden Wilhelm II. inzwischen selbst als Problem angesehen.
Beide wollten den Kaiser zum Thronverzicht bewegen und fanden in Ebert einen Verbündeten, der glaubte, so die Monarchie bewahren zu können. Eberts Begründung: Sonst „ist die soziale Revolution unvermeidlich. Ich aber will sie nicht, ja, ich hasse sie wie die Sünde." Der MSPD-Führer habe sich für eine konstitutionelle Monarchie ausgesprochen, habe Max von Baden in seinen Erinnerungen festgehalten.
Beide wollten den Kaiser zum Thronverzicht bewegen und fanden in Ebert einen Verbündeten, der glaubte, so die Monarchie bewahren zu können. Eberts Begründung: Sonst „ist die soziale Revolution unvermeidlich. Ich aber will sie nicht, ja, ich hasse sie wie die Sünde." Der MSPD-Führer habe sich für eine konstitutionelle Monarchie ausgesprochen, habe Max von Baden in seinen Erinnerungen festgehalten.
Schicksalstag 9. November 1918
Doch die Stimmung im Land und in der Reichshauptstadt habe sich unterdessen weiter zugespitzt, weshalb Ebert weiter darauf drängte, den Kaiser zum Abdanken zu zwingen. Und so sei der 9. November zum Schicksalstag der deutschen Monarchie und der deutschen Revolution geworden, schrieb der Historiker, der mit Blick auf Ebert meinte: „Die Revolution aber lieferte sich an diesem Tag dem Mann aus, der entschlossen war, sie zu ersticken."
Die bewaffnete Macht in der Reichshauptstadt lag laut Haffners Bericht bereits in den Morgenstunden in den Händen der SPD. Deren Abgeordneter Otto Wels hatte das aus Naumburg eingerückte Jägerregiment, das die Revolution niederhalten sollte und bereits im Osten gegen die russischen Revolutionäre eingesetzt worden war, unter Kontrolle gebracht. Sein Argument: Sie sollten einen Bürgerkrieg verhindern. So brachte er ebenfalls die anderen Truppen der Berliner Garnison auf MSPD-Kurs und wurde bereits einen Tag später zum neuen Stadtkommandanten ernannt.
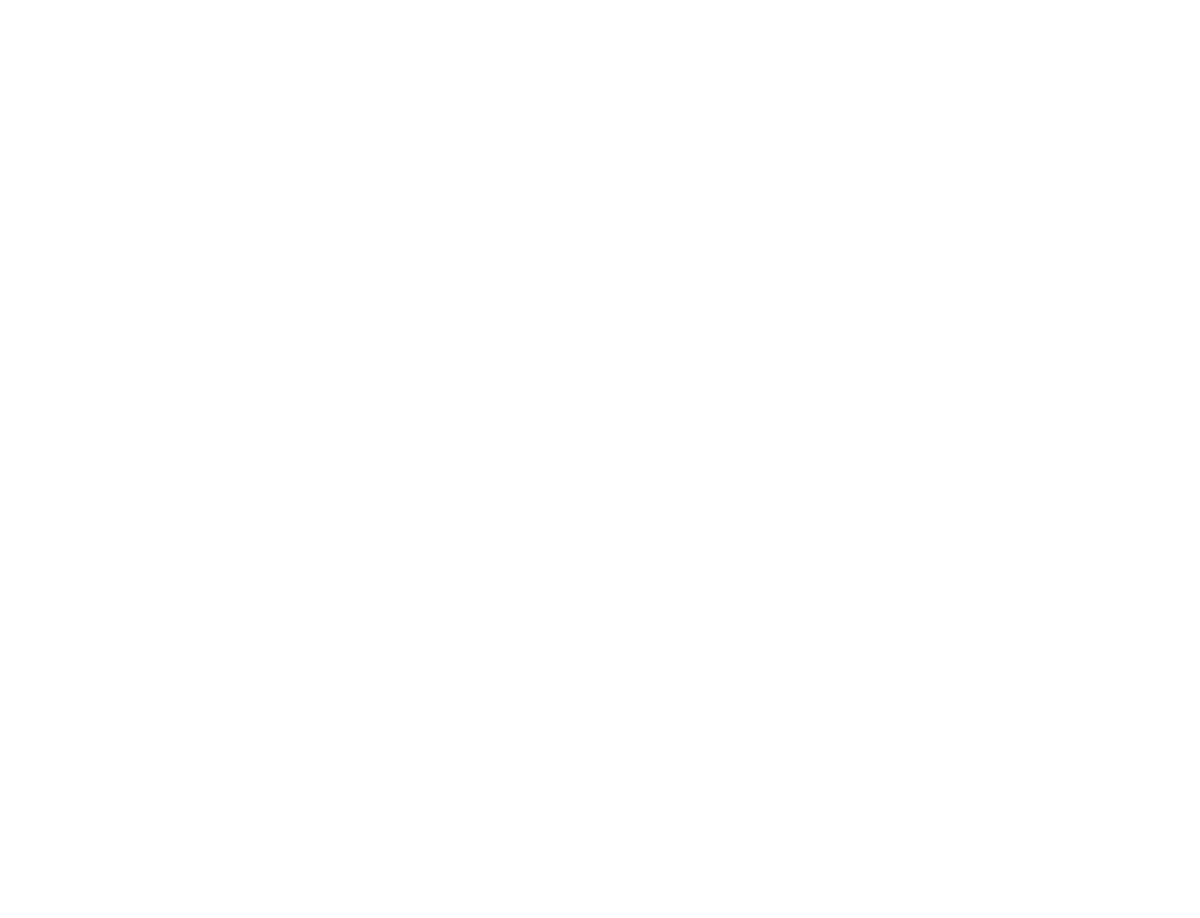
Ausrufung der Republik am 9. November 1918 durch den SPD-Politiker Philipp Scheidemann in Berlin
Der Historiker stellte fest: „Das bedeutete an diesem Tag das Ende des Kaiserreichs. Schon am nächste Tage sollte es das Ende der Revolution bedeuten." Das Kaiserreich habe angesichts der kampfunwilligen Truppen kein Machtinstrument mehr gehabt, um seine Existenz zu verteidigen. Max von Baden, General Groener und Ebert sei an dem 9. November klar geworden, dass es nur noch darum ging, um jeden Preis die Revolution zu ersticken.
Wofür Scheidemann sein Mittagessen stehenließ
Die drei hätten aber wenig abgestimmt gehandelt, während große Demonstrationszüge ins Berliner Zentrum gemeldet wurden. Noch in der Nacht war der Generalstreik ausgerufen worden. So sei es dazu gekommen, dass der Reichskanzler von Baden gegen Mittag des Tages bekannt gab, der Kaiser danke ab – ohne dass dieser bereits zugestimmt hatte. Ebert habe kurze Zeit später den Kanzler aufgefordert, ihm die Regierung zu übergeben, samt des Personals, von dem nicht ein Minister oder Staatssekretär gehen musste. Die erste Amtshandlung des neuen sozialdemokratischen Reichskanzlers war laut Haffner ein Aufruf an die marschierenden Berliner Arbeiter: „Verlasst die Straßen! Sorgt für Ruhe und Ordnung!"
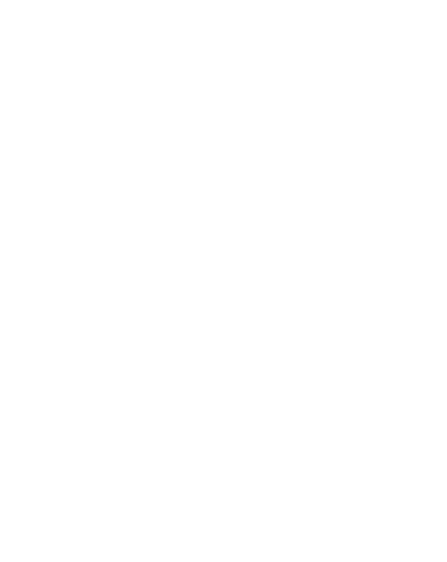
Scheidemann ruft vom Westbalkon
(zweites Fenster nördlich des Portikus) des Reichstagsgebäudes die Republik aus.
(zweites Fenster nördlich des Portikus) des Reichstagsgebäudes die Republik aus.
Der Historiker beschrieb das Geschehen an dem Tag als Tragikomödie: Die verkündete Abdankung des Kaisers sei ebenso wie Eberts Aufruf zu Ruhe und Ordnung von den Massen nicht mehr wahrgenommen worden. Während die MSPD-Funktionäre und -Abgeordneten im Reichstag Mittag aßen, seien die Demonstranten vor dem Gebäude angekommen und hätten gerufen: „Nieder mit dem Kaiser, nieder mit dem Krieg!" sowie „Hoch die Republik!"
Daraufhin habe der MSPD-Abgeordnete Philipp Scheidmann sein Essen stehen lassen und sei ans Fenster des Reichstages getreten, um den Massen entgegen
Daraufhin habe der MSPD-Abgeordnete Philipp Scheidmann sein Essen stehen lassen und sei ans Fenster des Reichstages getreten, um den Massen entgegen
zu rufen: „Das Volk hat auf der ganzen Linie gesiegt!" Und: „Es lebe die deutsche Republik!" Das stieß den Berichten nach vor allem bei einem Mann auf Widerspruch: Ebert, der Scheidemann vorwarf, er habe nicht das Recht, die Republik auszurufen.
Republik in doppelter Ausführung
Kürzlich hatte der Historiker Lothar Machtan, Autor des Buches „Kaisersturz - Vom Scheitern im Herzen der Macht 1918", in der Wochenzeitung „Die Zeit" auf Hinweise aufmerksam gemacht, dass Scheidemann eventuell doch nicht die Republik ausgerufen habe. Der MSPD-Politiker habe dagegen die Massen vor allem aufgefordert, Ruhe zu bewahren und nach Hause zu gehen. „Mehr war da wohl nicht", meinte Machtan über die aus seiner Sicht unwahre Legende. Allerdings hat ihm ebenfalls in „Die Zeit" der Historiker Heinrich August Winkler, Autor von „Weimar 1918-1933 – Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie", widersprochen und an zeitgenössische Belege erinnert, nach denen Scheidemann doch die deutsche Republik ausrief.
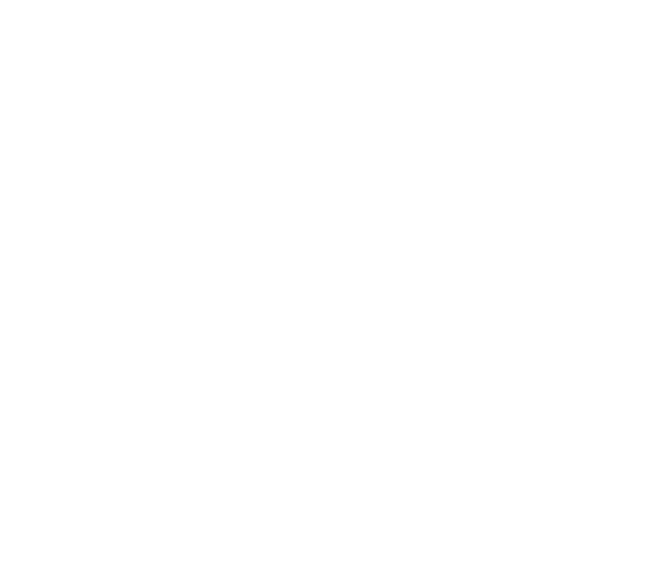
Flucht Wilhelms II. am 10. November 1918: Der vormalige Kaiser (vierter von links) auf dem Bahnsteig des belgisch-niederländischen Grenzübergangs Eysden kurz vor seiner Abreise ins niederländische Exil.
National Archives and Records Administration
National Archives and Records Administration
Während dieser Ereignisse am Reichstag erhielt laut Haffner nicht nur der Kaiser die Nachricht, er habe angeblich abgedankt – was er tatsächlich erst drei Wochen später von Holland aus nachholte. Eine der Folgen war, dass Wilhelm II. aus dem Hauptquartier in Spa abreiste und floh, obwohl ihn niemand bedrohte.
Kurze Zeit später an diesem 9. November wurde wie bekannt die Republik ein zweites Mal ausgerufen, diesmal von Karl Liebknecht. Die Massen waren inzwischen zum Königlichen Schloss weiter gezogen und hatten es besetzt. Von dessen Balkon rief der linke USPD-Politiker und „Spartakusbund"-Anführer: „Parteigenossen, ich proklamiere die freie sozialistische Republik Deutschland!"
Kurze Zeit später an diesem 9. November wurde wie bekannt die Republik ein zweites Mal ausgerufen, diesmal von Karl Liebknecht. Die Massen waren inzwischen zum Königlichen Schloss weiter gezogen und hatten es besetzt. Von dessen Balkon rief der linke USPD-Politiker und „Spartakusbund"-Anführer: „Parteigenossen, ich proklamiere die freie sozialistische Republik Deutschland!"
100 Jahre Novemberrevolution in Deutschland
Dieser Beitrag ist ein Teil der Sputnik-Reihe zum 100. Jahrestag der Novemberrevolution. Um zwei andere Beiträge dieser Serie sowie weitere Artikel der Sputnik-Autoren über die historischen Ereignisse, die zur Abdankung des Kaisers und zur Ausrufung der deutschen Republik führten, zu lesen, klicken Sie auf den Button unten.
Design von Erkin Rasulev
Sputnik Deutschland 2018
Sputnik Deutschland 2018
